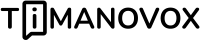Der IAB ist in § 7g des Einkommensteuergesetzes (EStG) geregelt. Hierfür dürfen bis zu 50 % der geplanten Investitionskosten für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter vorab gewinnmindernd abgezogen werden. Diese Rücklage kann für maximal drei Jahre bestehen bleiben. Innerhalb dieser Zeit muss das geplante Wirtschaftsgut angeschafft und in Betrieb genommen werden. Erfolgt die Investition nicht, muss der Abzugsbetrag rückwirkend aufgelöst und nachversteuert werden.
Ziel des Gesetzgebers ist es, Investitionen zu fördern. Da die Steuerersparnis bereits vor der eigentlichen Investition wirksam wird, kann Kapital für andere Zwecke freigesetzt werden – etwa für die Vorbereitung oder Finanzierung der Investition.
Der IAB ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So darf der Gewinn des Unternehmens im Jahr der Bildung des IAB bestimmte Grenzen nicht überschreiten (aktuell 200.000 Euro bei Bilanzierenden). Zudem muss es sich bei der geplanten Investition um ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens handeln, das voraussichtlich zu mindestens 90 % betrieblich genutzt wird.
Durch die Nutzung des IAB können Unternehmen nicht nur Steuern sparen, sondern auch gezielt Investitionsprojekte planen und vorbereiten. In Kombination mit modernen Direktinvestments, z. B. in Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher oder Tiny Houses, ergeben sich interessante Gestaltungsspielräume für unternehmerisch denkende Steuerpflichtige.