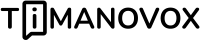Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ist ein äußerst attraktives Instrument zur Steuergestaltung – besonders für vermögende Privatpersonen mit hoher Steuerlast durch Einkommen, Boni oder Abfindungen. Doch wie bei jedem Steuervorteil gilt: Wer profitiert, muss auch die Spielregeln genau kennen. Denn falsche Anwendung oder fehlende Umsetzung kann steuerlich teuer werden.
Das größte Risiko liegt in der Nachversteuerung.
Wird die geplante Investition – etwa in eine Photovoltaikanlage oder einen Batteriespeicher – nicht innerhalb von drei Jahren realisiert, muss der zuvor abgesetzte IAB rückwirkend aufgelöst werden. Das bedeutet konkret: Die Steuerersparnis, die Sie im Jahr der IAB-Bildung genutzt haben, wird Ihnen nachträglich aberkannt. Dazu kommen in der Regel Nachzahlungszinsen, die 15 Monate nach Ablauf des Investitionsjahres anfallen können.
Ein weiteres Risiko besteht in der fehlenden Dokumentation. Die geplante Investition muss nachweisbar sein. Finanzämter verlangen regelmäßig Angebote, Projektplanungen, Reservierungen oder ähnliche Belege aus dem Jahr der IAB-Bildung. Wer hier unvorbereitet ist oder lediglich „Absichtserklärungen“ vorweist, riskiert, dass der IAB steuerlich nicht anerkannt wird.
Zudem darf der Gewinn im Jahr der IAB-Bildung 200.000 Euro (bei bilanzierenden Betrieben) nicht überschreiten. Liegt der Gewinn höher oder handelt es sich nicht um einen betrieblich genutzten Gegenstand, kann der Abzugsbetrag vollständig gestrichen werden.
Der IAB bietet große steuerliche Vorteile – wenn er korrekt eingesetzt wird. Die häufigsten Risiken liegen in versäumten Investitionen, unzureichender Planung oder fehlender Dokumentation. Wer jedoch frühzeitig und strategisch plant, die Investition ernsthaft vorbereitet und sauber dokumentiert, kann diese Risiken weitgehend ausschließen. Für einkommensstarke Privatpersonen mit unternehmerischer Denkweise ist der IAB daher ein wirkungsvolles, aber auch verantwortungsvolles Steuerinstrument.